 index reiseberichte.... zurück.... weiter index reiseberichte.... zurück.... weiter
|
POLEN II. 1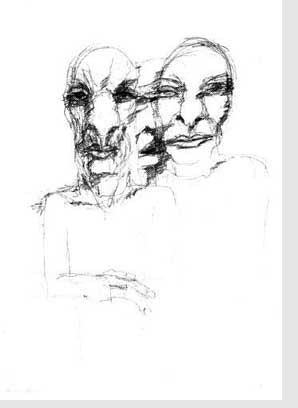 Przemysl. Die meisten steigen um auf Busse. Manche sitzen noch bis Wroclaw, noch zehn Stunden in diesem Gestank.
Przemysl. Die meisten steigen um auf Busse. Manche sitzen noch bis Wroclaw, noch zehn Stunden in diesem Gestank.
Nicht weit vom Bahnhof finde ich ein Hotel. Ohne Frühstück. Mein Zimmer ist im dritten Stock. Mit Waschbecken. Ohne Klo. Ich rufe Wieska an: "In drei Tagen bin ich wieder da." Es ist heiss. Die Kirchen sind voll. Viele Priester in schwarzen Soutanen. Viele kleine Mädchen in langen weissen Kleidern: Bräute Jesu. Ganze Häuserzeilen verfallen. In Schaufenstern liegen Zahnbürsten. Man geht in Cafés, Kneipen. Ich habe Hunger. "Das gibt es nicht. Das auch nicht." Was auf den Tellern liegt, sieht nicht allzu appetitlich aus. Unter Arkaden sehe ich den ersten Judenstern, durchgekreuzt. Ich habe Angst vor den Besoffenen. Am Abend laufen die Bräute Jesu, geführt von Priestern in schwarzen Soutanen, singend durch die Strassen. Ich gehe in ein Restaurant. Auf den Tischen liegen weisse Decken. Einer setzt sich neben mich: "Darf ich." "Ja." "Ein Bier." Ich sehe ihn mittags schon in dem anderen Restaurant. Als müsse er sich mit einem Glas in der Hand auf einen Stuhl zwingen, sprechen um nicht zu bersten. Um zwei Uhr nachts geht er über die Grenze. Holt Kartoffeln. "Ist die Marge so gross?" "Ja." Am frühen Morgen muss er wieder hier sein. Er ist aus Sanok, wir sprechen über Sanok. "Gehen Sie mit mir tanzen, bis ich rüber muss." "Nein." Um halb vier stehen die ersten um mich herum auf. Ich frühstücke in der Stadt, wechsle Geld, kaufe eine Zahnbürste. Ich muss meine Fahrkarte nach Krakau kaufen. Ich dachte schon viel gesehen zu haben, und noch mehr ist es der Geruch, der berichtet. Ich wollte drei Tage in Przemysl bleiben. Ich weiss nicht, ob ich das noch will. Reist du, wie ich es tue, weisst du, dass du zu gewissen Stunden, an gewissen Orten eine Gefangene des eigenen Geschlechts, des Alleinreisens und des Geldes bist. Misstrauen kommt auf. Das Hotel ist schäbig. Es wird sauber gehalten. Westliche Ausländer gibt es hier nicht. Wahrscheinlich sind alle, die hier absteigen, Handelsreisende. Ich habe mich vor Einbruch der Dunkelheit auf mein Zimmer zurückgezogen, schreibe alles auf, schicke es morgen gleich weg, du sollst es schnell haben. Ich könnte mir beim Ausarbeiten der Notizen später vielleicht selbst nicht mehr glauben, begönne zu zweifeln. Ob ich in dieser Kulisse schlafen kann? Auch auf meiner ersten Reise zeichne ich Angst. Damals ist ein Nein noch ein Nein. Vielleicht habe ich immer nur Massel. In Przemysl bin ich zum ersten Mal allein. Was ich 1979 direkt erfahre, erfahre ich jetzt erst am Vorabend der dritten Woche.
Krakau. Es ist noch sehr früh. Krakaus Bahnhof liegt voller schlafender Menschen. "Wir haben Angst vor dem sich Öffnen der Grenze nach Osten", sagt der Regisseur des Warschauer Studio Theaters, übersetzt die Frau, die ihn begleitet, "das ökonomische Gefälle ist zu stark." Die Schlitze seiner Augen hinter der winzigen Brille. Die Tassen sind leer, sie erheben sich: "Die Proben." Ich streiche ihn aus meiner Kartei. Das Kazimiersz liegt verwaist. Das macht es noch trostloser.
Warschau. Ich laufe entlang dem unerbittlich wuchernden Russenmarkt. Erschöpfung und Hitze stauen sich in Gesichtern, Haltungen, Gebärden, dunsen die Menschen auf. Es ist beinahe Abend.
Masuren. Wieska und ich fahren nach Masuren. An einem der Seen da haben sie ein Sommerhaus. Morgen kommen noch Freunde mit einer Tochter und der Freundin der Tochter und einem Freund aus Amerika. Zum Johannisfeuer. Der Freund ist Psychologe. Er arbeitet mit taubstummen Kindern. Seit zehn Jahren lebt er in Amerika. Es ist sein erster Polenbesuch seit fünfzehn Jahren, seit er von hier weg ist. Tagelang sitzt er bei den Freunden, zittert. Wieska hält bei Soldatengräbern am Strassenrand, deutschen Soldatengräbern: Hier ruht... 1915... Wenn sie nicht da sind, gehört das Haus Fledermäusen. Wir reissen alle Fenster auf. "L., Herbert. Sechzehneinhalb bin ich, als der Krieg zu Ende ist. Ich habe Glück. Ich brauche nicht mehr an die Front. Ich spreche schlecht deutsch. Vierzig Jahre keine Übung. Das Polnisch kommt mir leichter. Laufe vor der Russenfront weg. Berlin. Spandau. Dann bin ich wieder hier. Viele machen weg. Ich nicht. 50 Kilometer mit Pferd und Wagen kommt die Mutter. Dann geht sie zurück. Die Russen nehmen Pferd und Wagen. Die Mutter muss zu Fuss zurück. Ja, 50 Kilometer wird sie weit gekommen sein. Bis vor drei Jahren lebe ich mit der Frau zusammen. Nicht verheiratet. Ein Zimmer. Vor drei Jahren stirbt die Frau. 600 000 Zloty Rente. Muss weiter arbeiten. 1971 macht die Mutter in den Westen. Ja. Nein. Wo der Vater wohnte. Der ist dann tot. Aus russischer Kriegsgefangenschaft wird der Vater 1953 nach Westdeutschland entlassen. Ich bleibe hier. Nein, ich rauche nicht. Waldarbeit. Ich koche selbst. Manchmal arbeite ich für Leute. Dann bekomme ich meine Mahlzeit." Die Freunde mit den Kindern und dem Freund kommen. Als die Kinder im Bett sind, sitzen wir noch lange in der Küche, reden. Ich zeichne den Waldarbeiter aus der Erinnerung, finde ein Gesicht, das ganz anders ist. Die Augen, die ich finde, zeugen von Angst. Das Kind setzt seine Stimme gezielt hoch an, presst sie so zusammen, dass allein schon dieser Ton mich mürbe macht. "Ich liebe die russische Sprache", sagt der Freund, "liebe die russische Literatur. Ich kann Russen nicht ertragen. Nein, man kann nicht normal mit ihnen umgehen. Sie lügen. Stehlen. Das Regime, siebzig Jahre lang, hat Lügner, Diebe aus ihnen gemacht. Sie phantasieren. Antworten nicht auf deine Fragen. Nehmen sich einfach." Verstehe ich die Worte nicht, verlagert sich meine Aufmerksamkeit auf den Rhythmus, die Melodie, Klangfarbe, Gesten, Gerüche. Das erfahre ich bewusst auf meiner ersten Polenreise. Auch schon, als ich 1959 zum ersten Mal nach Utrecht komme. Wir schwimmen, laufen durch die Wälder, essen, trinken. Ich döse in der Hängematte. Ganz früh laufe ich allein zum See. Es gibt hier Störche.
Das Tatarengesicht der Frau, die waagerechten Augenbrauen. Ihre Bewegungen aus dauernder Lethargie. Die Glut des Johannisfeuers auf meiner Haut schlafe ich beinahe ein. Der Mond wird rot. "Weinen löst nichts", sagt der Freund, "es sitzt zwischen deinen Ohren, unter deiner Schädeldecke. Weinen hilft nichts, du musst es akzeptieren." Manchmal fällt Wasser aus meinen Augen. Heiss. Salzig.
Warschau. Das Wochenende ist vorbei. Wieska muss in einer Kleinstadt vor Warschau etwas erledigen. Auch hier der wuchernde Handel. Die Freunde und deren Freund aus Amerika sind von hier. Ich rufe wegen eines vereinbarten Interviews an. Seit einer Woche besteht die Zeitung nicht mehr. Er ist nervös. So winzige feingliedrige Hände. Kinderhändchen. Er hat überlebt, ausserhalb des Gettos: "Die Mauer in Berlin, dreissig Jahre, unmenschlich." "Alles, was durch Menschen geschieht, ist menschlich." "Manchmal ist es jenem zu viel, zu leben mit dem, was war. Der Künstler sei einzementiert in den Ort des Geschehens, sagt er. Warum hat er diese Schübe! Es ist doch vorbei." "Das gespaltene Material bleibt strahlen." "Das ist es. Mir graut vor der auf uns zukommenden McDonald-Kultur, vor unserer Ohnmacht dieser Kultur gegenüber. Meine Tochter wohnt in Israel. Es ist schön dieses Land zu sehen, in dem unsere Menschen keine Aussenseiter sind. Vor der Intifada. Jetzt? Wir bringen 'Das Phänomen Bruno Schulz' in der dritten Nummer. Sie gehören zur Redaktion." "Wir sind nicht fähig der Einflussnahme und dem Gieren nach unserer hohlen Einheitskultur entgegenzuwirken", sagt der westliche Kulturbeamte. "Wir brauchen ihr Kommen und Kommenlassenwollen, ökonomisch auf alle Fälle, nicht zu unterstützen", gebe ich zurück. "Das sind die Spielregeln der Demokratie." "Nein, das sind die Spielregeln brutalsten ausbeuterischen Bandentums." Auf dem Russenmarkt kaufe ich eine Menge leckerer Sachen. Wo haben sie all die Zahnbürsten her. Morgen hat Wieska Geburtstag.  ... ... Die erste Zeichnung entsteht am Abend vor ihrem Geburtstag, die zweite nur wenige Tage später. Am Abend zeichne ich sie. Das ist immer riskant. Ich weiss ja nicht, was sich auf dem Papier zeigt. Wieska liest. Dann merkt sie, dass ich sie zeichne: "Soll ich noch so sitzen bleiben." "Lies weiter."
Wieskas Fest. Vor der Tür stehen die Freunde, die mir im Juni 1983 in Warschau sagen: "Rufe Wieska an, wenn du wieder in Holland bist, ihr versteht euch bestimmt." Wir fallen uns in die Arme. Damals sind Wieska und Z für drei Jahre in Groningen. Ihre Zeit ist beinahe um. Auf meinen Anruf hin kommen sie nach Zaltbommel, sofort. Ich spreche über temperaturlose Räume. In einem meiner Texte tauchten sie auf. "Das gibt es nicht", sagt Z, "Räume, Zeiträume existieren dank Unterschieden in Temperatur." Ich decke den Tisch. Stundenlang tafeln wir, trinken Wein, sprechen, als kennten wir uns schon immer. Sie bleiben das ganze Wochenende. Irgendwo legen wir Matratzen für sie hin. Immer kennzeichnet diese Selbstverständlichkeit unsere Begegnungen, ob kurz oder lang, in den Niederlanden, in Warschau. Die Freunde, die nach Masuren gekommen waren, kommen mit dem Freund aus Amerika und dem Bruder der Frau (mit dem Tatarengesicht), der auch in Amerika wohnt, und dessen junger Frau. In Amerika geboren, spricht diese junge Frau fehlerlos amerikanisch und fehlerlos sächsisch. Sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben in Europa. Er zum ersten Mal wieder in Polen, seit er von hier weg ist. Sie weiss nichts von ihrem Akzent. Noch ein Vetter aus Kanada und noch zwei Freunde kommen. Auf der Balustrade hockt eine Elster. Wir sprechen, tanzen, trinken, essen bis ins Morgengrauen. Die Freunde, die auch in Masuren waren, und der Freund aus Amerika bleiben schlafen. Um sechs Uhr müssen die Freunde zur Arbeit. Ich stehe mit ihnen auf, lasse sie raus, setze mich in die Küche. Wieska schläft noch, der Freund aus Amerika auch. Mein Schädel brummt. "Und? Wenn du nachhause kommst? Was dann? Hast du gefunden, was du gesucht hast?", fragt der Freund, der sich zu mir setzt. "Was hat sich geändert? Wie beantwortest du diese Fragen?" "So wie ich wieder hinkomme, lebe ich dann da, bis ich wieder losziehe." "Warum musst du weg? Warum diese und nicht eine andere Reise?" "Ich befinde mich auf dieser Reise." "Das ist nicht genug." "Es ist so." "Um die Belastbarkeit deiner Haut auf die Probe zu stellen?" "Und du?"
Um 14 Uhr 30 in der Universität. Ein Gespräch mit einem Literaturwissenschaftler. Wie schwer Wissenschaftler sich damit tun, dass Kunst geschieht und dass das Wissen, das aus dem Dargestellten auf uns zukommt, jenseits aller Erklärungen und Begriffe liegt, auch wenn Sprache das Mittel ist. Im Kellercafé auf dem alten Markt schreit Discomusik einem die Ohren taub.
Wie verlautet, nimmt Moskau Züge und Busse aus dem Interverkehr um den wilden Handel zu unterbinden. Sie wollen eine bessere Grenzregelung mit Polen. Wieder gehe ich zu diesem abblätternden Wohnblock mitten in der Stadt, zu dem Mann, dessen Bescheidenheit an Erliegen grenzt. Als ich die Tür zum Fahrstuhl öffne, steht der Hund neben mir, kommt mit in den Fahrstuhl. "Geh!", sage ich. Er geht nicht. Fünfzehn Etagen allein mit dem Hund. Ich öffne die Tür. Der Hund bleibt im Fahrstuhl. Die Tür schliesst sich. Heute vor fünfzig Jahren erschiesst ein SS-er den Schriftsteller Thadeus Boy Jelenski in Lemberg. Der Buchhändlerclub lädt zu einer Gedenkstunde ein. In den dreissiger Jahren schreibt Jelenski über Scheidung, Abortus, Atheismus. Damals haben seine Schriften es schwer. Während des kommunistischen Regimes wollen die Schriftsteller seine Schriften, ihn, nicht vom Regime missbrauchen lassen. Jetzt, wo Pressefreiheit herrscht, haben seine Schriften es wieder schwer. Die katholische Spitze ist gegen ihre Veröffentlichung. Das ist ohne direktes Verbot möglich: es gibt kein Papier, nicht dafür. Woityla spricht vom Europa des Christentums. Sie sprechen vom Europa der Literatur, der kulturellen Verbundenheit. Einer steht auf: "Hiermit rufen wir den Atheistischen Verband Polens wieder ins Leben." Danach stürzen wir uns auf den Tisch mit Häppchen und Wein und Erdbeeren. Das Europa der Literatur! Die Reflektion ist am Ende, die Zukunft gehört der Kunst! Welcher Literatur? Welcher Kunst? Welcher kulturellen Verbundenheit? Kunst und Literatur sind Mittel, vermitteln. Wir müssen zusehen und zulassen, dass wir die Mittel rückhalt- und bedingungslos handhaben. "Es ist nicht aufgeräumt, R ist mit Suppe für das Enkeltöchterchen zu unserer Tochter gefahren, vielleicht ist sie noch gar nicht wieder da." Sie kommt aus dem Bad. Steht im Korridor. Aschen. Glattes Haar. Schwarz. Der Korridor ist verwohnt. Ich stelle meine Tasche mit den Zeichnungen ab. Er wollte nach dieser Gedenkstunde die Zeichnungen sehen, mit mir essen gehen. Er zeigt mir das Klo und das Bad - das Klopapier hängt an einem Bindfaden -, steht da mit einem Handtuch, als ich rauskomme. Drei Zimmer, Bad, Klo und der Korridor. "Wir gehen essen, nur essen", sagt er, "dann kommen wir zurück." "Oder nicht", sagt sie. Wir gehen. Der Schauspielerclub von damals existiert nicht mehr. Damals herrscht hier reges Treiben, ist das Essen nicht üppig, stehen die Tische kreuz und quer, trällert die mit der babyrosa Strickjacke, den rosa Söckchen, verlatschten Schuhen, fisseligen roten Haaren: "Ich spreche alle Sprachen!", blättert die Täfelung ab, winkt man dem und dem zu, lacht. Jetzt ist der Club privatisiert. Aufgeräumt. Nur wenige Tische stehen im Raum. Das Essen ist ausgesucht. Es fehlt die rosa Strickjacke, das fissilige Haar. Gleich nach dem Essen gehen wir. Ich hole nur meine Tasche. "Der bequemere Import aus dem Westen, von auch noch besseren Gütern und schöneren Verpackungen, lässt die eigene Wirtschaft verkümmern. Polen ist für den Westen ein Markt, ein schneller Markt." Darin die müde, hier und da aufgekratzte Menschenmenge. "Sie sind munter", sagt jemand.
Heute, nach sechs Wochen Niederlanden, kommt Z wieder nachhause. Wir holen ihn vom Flugplatz ab. "Im Zug von Groningen nach Schiphol wurde mir schwarz vor Augen, am Boden liegend wurde ich wach, niemanden kümmerte es", sagt er.
"Vielleicht ist dieser Bazar zu Füssen des ehemaligen Kulturpalastes unser einzig wirkliches Zukunftsbild. Was macht der, der hier dann mit seinem rosa phosphoreszierenden Schnickschnack sitzt, nicht alles durch, ehe er hier überhaupt ankommt." "Ist das Zynismus oder wahr", fragt der Deutsche. "Die Wahrheit schert sich nicht darum, ob wir sie Zynismus nennen oder sonst wie." "Für den Polen bedeutet es eine Degradierung im Westen Strassenhandel zu betreiben", sagt der Pole. "Einst waren die Juden die Strassenhändler, jetzt sind sie Soldaten; waren die Polen die Soldaten, jetzt sind sie Strassenhändler", sagt der polnische Jude. "Jetzt stinkt das Geld, riech nur." "Ich habe Angst mein Haus zu verlassen, in Urlaub zu fahren." "Warschau ist furchtbar." "Immer werden wir von Banden regiert. Es sind Banden. Jedes System, jede Moral ist ihnen für ihre Machenschaften recht."
"Wenn alles in Chaos endende Turbulenzen erfahren kann, gilt das auch für Zeit", frage ich Z. "Diese Frage ist so noch nicht gestellt worden", sagt er. "Ich stelle sie so. Ich erfahre Augenblicke, in denen alle Perspektiven unvermittelt wegfallen, Gesichter, Leiber, Fronten auf mich zuschnellen, ein Abhandensein jeglicher Richtung herrscht." "Für den Physiker, den Mathematiker ist Dichtung, ist Malerei, dieses ohne Richtung der Zeitbindung Auf- und Ineinanderliegen von Geschehnissen nichts Aussergewöhnliches."
Ich weiss, wo die zwei überrealistischen, ehemals vorbildlichen Fassadenfiguren, der kräftige junge übergrosse Arbeiter und die kräftige junge übergrosse Arbeiterin und Mutter, stehen. Ich will sie fotografieren, man will sie vernichten. Ich finde sie nicht. Dann fahre ich mit der Strassenbahn wieder an ihnen vorbei. Ich weiss nicht, wann genau sie anfingen diese Holzüberdachungen in die Strassen einzuziehen. Sicher schon vor 1983. Runterstürzende Fassaden erschlugen Passanten. Diese Korridore entlang den Fassaden der Häuserblocks aus den fünfziger Jahren durchsetzen die Stadt wie der Russenmarkt. Niemand fällt dem Fassadenschlag mehr zum Opfer. Das Runterkrachen, der Aufschlag. Noch immer ziehen die Menschen die Köpfe ein.
Krakau. Ich wohne im U Pollera, einem alten Hotel mitten in der Stadt. Fünf Tage bleibe ich, dann fahre ich anlässlich zweier Gespräche noch einmal nach Warschau. Mir ist, als müsse ich, jedes Mal bevor ich weiterkann, noch einmal zurück stechen um nachzusehen, ob nichts, was mich noch ausmacht, liegen geblieben ist. Rätselhaft, wo und wann schon Entscheidungen in uns gefällt werden. Und wir wissen, dass wir es wissen. Für eine Tasse Kaffee kann ich an einem Tisch sitzen, für eine Mahlzeit länger. All die Menschen. Gerümpften Nasen. Der Käse in Körben. Spiele. Roma vor Geschäften, in Kirchen, vor Kirchen. Die Garderobenmasse sind gross. "Nehmen Sie auf alle Fälle mit dem Direktor vom Goethe Institut in Krakau Kontakt auf", hatte der Direktor vom Goethe Institut in Warschau gesagt. Einer steht am Apparat, hantiert mit Papieren. Der Apparat spuckt Blatt auf Blatt auf ganze Stapel schon ausgespuckter Blätter. Es ist heiss. "Frau Vess darf zwischendurch an den Apparat, das ist in Ordnung, ja?" Deutschland trifft mich im Herzen Polens. Mit geblähten Nasenflügeln, auf die Zähne gedrückten Lippen, immer hochgetriebenen Stimmen, "Was hast du da! Igittigitt!", aufgerissenen Augen, gerunzelten Stirnen, nach vorn gestreckten Kinnen, hochgezogenen Schultern, runter gezogenen Mundwinkeln. "Reiss dich zusammen!" Ihr Gelächter bricht irgendwo in ihren Köpfen aus. "Das ist ein Witz!" und sie schlagen sich auf die Schenkel. "Zwei Stunden kopiere ich schon. Ich weiss nicht mehr, was das Original ist und was die Kopie." Sein Gesicht ist feucht. Die Papiere fallen. "Wir leben in einer verrückten Zeit", sagt der Organisator des Festivals der Jüdischen Kultur am Telefon. Freitag um 11 Uhr im Hotel. Donnerstagabend liegt ein Bericht beim Empfang. Es wird Samstag um 11 Uhr. Die Bitte des Schülers von Schulz um eine persönliche Einladung. Mehr als sie den Organisatoren nachdrücklich vorzutragen kann ich nicht tun. Da das Gespräch mit dem Organisator erst morgen stattfindet, ich erst weiss, dass es stattfindet, wenn er vor mir steht und auch dann nur eventuell, spreche ich beim Kulturdezernat der Stadt vor. Es müssen ja offizielle Stempel gesetzt werden. "Wir helfen", sagt die Dame und "gehen Sie, was ihre eigene Teilnahme betrifft, auch zu Frau A. Da organisieren sie das Festival Europäischer Kultur mit Krakau als Zentrum mit, dazugehörig, dem Jüdischen Festival mit, dazugehörig, einer Hommage an Bruno Schulz." "Holland is ziek" (ist krank), sagt die Dordrechter Künstlerin, auf die ich da treffe. Sie kommt gerade aus Odessa. Sie nennt sich Membrandt.
"Die farbige bildhafte Sprache von Schulz!", sagt der Literaturwissenschaftler, den ich noch vor dem Termin mit dem Organisator des Jüdischen Festivals treffe. "Für uns geht es um Atmen oder Ersticken. Der Leser, der Betrachter ist Zeuge."
Dann warte ich mit ihm beim Empfang des Hotels lange auf den Organisator. Ich hatte ihn gebeten bei dem Gespräch anwesend zu sein. "Polen kommen immer zu spät", sagt er. Der Organisator kommt, wir gehen auf mein Zimmer. Dann kommt auch die Dame vom Kulturdezernat noch. Auf dem Markt treffe ich auf die Jugoslawin, die beweisen kann, dass Schulz' 'Messias' in seinen Texten vorliegt. Sie steht da mit ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn, bittet Passanten sich in die Liste der Befürworter eines freien Sloweniens einzutragen. Sie ist Slowenin. "Slowenien ist kein Teil des Balkans: die lateinische Schrift, die römisch katholische Kirche. Man kann kein Volk zwingen in einer aufgezwungenen Brudergemeinschaft zu bleiben." Ein staatlicher Betrieb darf seinen Angestellten ein Monatsgehalt von 1 000 000 Zlotys bezahlen. Für jeweils 100 000 Zlotys mehr muss der Betrieb 500 000 Zlotys Strafe zahlen. Die Betriebe entgelten mit Naturalien, Handtüchern, Fahrscheinen für die städtischen Verkehrsmittel. Die Fahrkarten verkaufen die Leute an allen Strassenecken für 85% des Normalpreises. Wieder in Warschau, frage ich Wieska. Sie reisst die Schränke auf. Handtücher quellen hervor. In der Küche liegen ganze Stapel Fahrscheine.
Zum Frühstück trinken sie Bier. Heute lungern nur wenige Roma in der Stadt. Es ist Sonntag. Noch früh. Heute sitzen sie nicht vor der Kirche. Auf der Höhe der letzten Wohnsilos fangen die Hochöfen an. Nova Huta. Einst der nationale Stolz. "Hier verschmelzen Kultur, Wissenschaft und produktive Arbeit zu Kultur schlechthin", propagierten sie. Sie drosseln die Produktion. Entlassen massenhaft. Noch 25 000 bangen um ihre Stelle. Wer in diesen ihn zerfressenden Schwefelschwaden des täglichen Lebens im Schatten der Hochöfen seine Potenz nicht verliert, muss stärker sein als ein Auerochse. Sie landen in der Klinik hinter der Kirche, das Gebetbuch mit Goldschnitt, den Rosenkranz in der Hand, streichen der blonden Barbiepuppe über das glatte Haar. Bevor die Bahn das Gelände erreicht, wo nur noch Werke stehen, fährt sie uns an einer Kuh auf einer Weide vorbei. Dann kilometerlang entlang der Horrorkulisse - Horrorwahrheit, den verrostenden Anlagen, spuckenden Hochöfen, Bretterzäunen, den Toren zu diesen heiligen Stätten der Arbeit, durch die sich die Arbeiter, die noch nicht entlassen sind, hineinpferchen. Sie leben davon, ihre Frauen, Kinder. Endstation. Ich steige aus, um in die erste Bahn von hier weg, lande irgendwo inmitten von Wohnsilos. Man hat sich fein gemacht, bricht auf in die Stadt. Die Kirche ist aus, das Mittagessen gegessen. Dieser Plisseerock, diese weissen Söckchen, rosa Espadrilles. Neben ihr, der junge Mann mit langem Haar. Er wiegt ein Baby im Arm. Immer wieder streicht die Frau das Haar des jungen Mannes glatt. Lächelt, wie nur Mütter tun; grau das Gesicht, schwarz die tiefen Ränder. Der Sohn sagt nichts, wiegt das Kind. Dann ein paar Worte. Die Schönheit der Stadt, die ungeheure Schönheit mancher Menschen hier. Krakau hat Flecken, wo du die Misere vergisst. Ich liebe Krakau. Ich gehe durch das Spalier der Händler und Kreuze schlagenden Kinder zum Bahnhof. Irgendwo auf der Strecke bleibt der Zug drei Stunden lang stehen. Es ist entsetzlich heiss.
Warschau. Das erste Gespräch. "Wir sind unfähig uns selbst zu organisieren", sagt die Organisatorin, "wir kokettieren mit dieser unserer Unfähigkeit." "Zucker?" Ich gehe noch einmal ins Stehcafé vom 'Europejski', da gibt es den besten Kaffee Warschaus. Laufe noch einmal über den Russenmarkt. Kaufe eine Flasche Wein für heute Abend. Meine Fahrkarte nach Katowice. Morgen fahre ich nach Katowice. Komme dann nicht noch einmal her. Ich gehe zu niemandem weiter, rufe niemanden mehr an. |
 index reiseberichte index reiseberichte
|
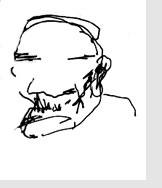 Im Schatten der Bäume sitzt der alte Kirgise, unerschütterlich, geraden Rückens, im Schneidersitz. Zahnlos. Vor ihm die Tasche, der eine Feldstecher, rosa Plastikschläger: schreiendes phosphoreszierendes Rosa. Den ganzen Tag sitzt er so da. Das Öffnen der Grenzen nach Westen spült Menschen aus Taschkent hier auf den Markt. Irgendwo kaufen sie allen möglichen Plunder auf, gehen nach Westen, sitzen da wie seit Generationen in Taschkent. Bei den Jungen sehe ich diese Unerschütterlichkeit nicht mehr; ihre Augen, ihre Gesten flattern. Vietnamesen sitzen in der Hocke.
Im Schatten der Bäume sitzt der alte Kirgise, unerschütterlich, geraden Rückens, im Schneidersitz. Zahnlos. Vor ihm die Tasche, der eine Feldstecher, rosa Plastikschläger: schreiendes phosphoreszierendes Rosa. Den ganzen Tag sitzt er so da. Das Öffnen der Grenzen nach Westen spült Menschen aus Taschkent hier auf den Markt. Irgendwo kaufen sie allen möglichen Plunder auf, gehen nach Westen, sitzen da wie seit Generationen in Taschkent. Bei den Jungen sehe ich diese Unerschütterlichkeit nicht mehr; ihre Augen, ihre Gesten flattern. Vietnamesen sitzen in der Hocke.
 Sie sitzen, als seien sie tot, hantieren mit Papieren: "Unsere Zeit hier verwest, unsere Hände, des Hantierens gewohnt, hantieren!"
Sie sitzen, als seien sie tot, hantieren mit Papieren: "Unsere Zeit hier verwest, unsere Hände, des Hantierens gewohnt, hantieren!"