 index reiseberichte.... zurück.... weiter index reiseberichte.... zurück.... weiter
|
ISRAEL 1Tel Aviv. Leute mit Pappschildern mit Namen drauf. Vom Flughafen aus buche ich ein Hotelzimmer für die ersten zwei Nächte. Es ist mir zu teuer, liegt auch nicht im Zentrum.Sommerabend im November. Südliche Gebärden. Männer in Schwarz. Frauen mit Haarnetzen über Perücken, wenig schmeichelhaften Röcken bis über die Knie und Wägelchen voller Kinder. Ich warte auf den Bus. Einer, der auch da steht, lebt in New York, geboren ist er in Deutschland. Der Junge neben mir im Bus muss zum Militär. Der Portier des Hotels kommt aus Russland. Zusammen mit einem Ägypter und dem Sohn seiner niederländischen Frau, die auch hier übernachten - "Sie sassen im selben Flugzeug", sagt er -, gehe ich noch essen. Im Restaurant habe ich das Gefühl, dass es darauf ankommt, dass man eben isst. Ich wollte ja nur raus aus dem Hotel. "Seit Sadat brauchen wir kein Visum mehr. Sadat ist ein Mensch." Er wollte seiner Familie seine Tochter und seine Frau zeigen, und ihren Sohn. Die Tochter ist noch zu klein für solch eine Reise. Klondike, denke ich beim Betreten des Frühstücksraums. Die Alte mit den schnoddrigen Gebärden, der glänzenden Haut der Hitze hier, den Falten der Jahre, die den Laden hier schmeisst, berlinert mit dem Alten, der ihr hilft. Menschen wie in Polen, Russland, Deutschland, sicher die älteren. Was sie anhaben, zeugt noch von da, auch Gang und Haltung. Es könnte jede osteuropäische Stadt sein, mit Sommer im November und Palmen und einer grossen Zahl dunklerer Gesichter und Gebärden und vollen Läden. Immer wieder treffen mich Anzeichen eines dauerhaften Provisoriums, sogar im Goethe Institut. Der Direktor ist Deutscher. Als haben sie noch nicht alle Koffer ausgepackt. "Nie wieder fahre ich nach Polen", sagt der Mann, mit dem ich da spreche. Wir sprechen Niederländisch. Geboren ist er hier. Seine Eltern gehen dann mit ihm zurück. Sein Land jedoch ist Israel. "Südlich Krakaus treffe ich den alten Juden, gehe mit ihm nach Hause. Er holt Thora und Gebetsriemen, rollt die Thora aus. 'Kaufen?' Sabine, so weit ist es gekommen, das ist übrig geblieben: die Thora verkaufen!" Gegen Abend gehe ich zu einem russischen Maler, dessen Adresse ich von einer in Riga geborenen, in Brüssel wohnenden Freundin meiner Schwester habe. Er wohnt mitten in der Stadt, unweit vom Strand. In der Nes Ziona Strasse, um die Ecke bei ihm, finde ich das Nes Ziona Hotel. Es ist billig. Es ist sauber. Morgen früh kann ich einziehen. Ich schreibe diesem Maler noch von Zaltbommel aus. Ich konnte ja nicht mehr davon ausgehen erwartet zu sein. Wunder treffen dich wie Blitze, reissen, katapultieren dich aus herrschenden Kräfteverhältnissen heraus. Aufgeklafft schaffst du dich weg, wie eine Katze, die ihre Todesstarre aufkommen fühlt, ihren Korb verlässt, ein Krebskranker, der nach der letzten Chemostation sein Skelett noch einmal über seine Grenzen hinausreisen lässt. Suchst Bestätigung und Unterkommen bei dem, durch den der Schlag dich getroffen hat. "Tee?" Der Maler faltet seine Hände im Nacken, streckt sich zurück. Seine Frau arbeitet für eine russischsprachige Zeitung. Sein Englisch ist schlecht. Das ihre etwas besser. Ich spreche weder Russisch noch Iwrith. Es ist nicht nur die Unkenntnis einanders Sprachen, die die Verständigung so schwierig macht. Es springt kein Funke über. Ich denke an die Wärme bei W's Freund in der Diaspora Moskau; auch wenn diese Wärme verduselt, die Augen trübt, den Abstand unwesentlich erscheinen lässt, wärmt sie, lässt Funken wenigstens aufkommen. Einer kommt, knallt eine Druckfahne auf den Tisch: "Sollen sie gleich die volle Hoffnungslosigkeit ihrer Situation in ihrem Zion bestätigt bekommen, so wie sie kommen und woher." "Krieg ist geil", quakt der Amerikaner in dem türkischen Restaurant. Er wirft Bomben. Seit zwanzig Jahren. "Wirklich geil. Nichts ist geiler als das Abwerfen von Bomben." Auf meinem Papier zeigt sich ein Gesicht ohne Nase, ohne Mund, ohne Augen, offenen Kinns. Damals, anhand der Texte von Bruno Schulz, stosse ich nach Jahren des immer von neuem Nachziehens und Aufdeckens von Spuren auf eben solch Gesicht. Ich ziehe um. Bei der Rezeption sitzt ein Alter, schreibt in Hefte, auf Zettel, die Nase beinahe auf dem Papier. Schaut auf. Mein Zimmer ist im dritten Stock. Fliesenfussboden mit Brücken. Die Wände sind kahl, die drei Betten: nicht mehr als das. Ein Schrank, ein Waschbecken, in der Ecke eine Dusche, ein Stuhl, drei Nachttische. Auf einem der Nachttische steht eine Vase mit frischen Blümchen. Ein Balkon zur Strasse raus. Die Balkontür schliesst nicht. Das Klo ist auf dem Flur. Eine Klingel, für den Fall, dass jemand mich am Telefon verlangt oder beim Empfang nach mir fragt. Es sieht nicht so aus, als habe dieses Hotel im Anfang gloriosere Zeiten gekannt. Es ist sauber. "Seit sieben Generationen wohnt meine Familie hier. Was Sie von Israel auch denken mögen", sagt der Alte, "unser Klima ist herrlich." Die Instanz, an deren Postfach ich meine Briefe an M adressiert hatte, ist nicht mehr hier. "In Jerusalem können sie Ihnen weiterhelfen." Was mich ihn suchen lässt? Jene zwei Stunden. Das Auge-in-Auge-Sein. Weder liess sich der Verlauf meiner Reise voraussagen noch, ob beide von uns die vereinbarte Station schaffen würden. Und hätten wir einander dann wieder erkannt? Ich musste diese Reise unternehmen, es gibt keinen anderen Grund. Keiner meiner Briefe an ihn ist zurückgekommen. Die Figuren vieler hier sind gedrungen, die Hälse nicht so lang. Sie kauen, stecken in ihre Münder, lesen kauend in Zeitungen. Der Nussverkäufer kommt aus dem Irak. Ich denke an dahingestellt Sein. Wieder taucht das Wort Figur in meinen Notizen auf wie in Berlin und in Moskau. Die Moschee Richtung Jaffa ist mit Metallplatten umstellt. Grund und Boden drum rum liegen brach, mit Halden Unrat, Brocken von Wänden, von Fliesen. Dahinter erhebt sich ein modernes Betonhotel, ein ganzer Betonkomplex. Von diesem Umbruchfeld der Stadt aus lande ich im Geschrei und Rausch der Gerüche des Carmelmarktes. Kürbisse, Avocados, "Sheqel! Sheqel!", Riesenmangos, Minze, das Schlachten von Hühnern, von Lämmern, ihr Blut in der Gosse, Fische, Brot, Kleidung. Ich kaufe eine Avocado, eine Melone. "Was verlangt er? Passen Sie gut auf, er bescheisst jeden." Ich kann nicht feilschen. Manche kommen erst gegen Abend, wenn die Händler die Stände wieder abräumen, ans Verschleudern gehen. Frühstück im Stehcafé an der Ecke. Der Frau hinter dem Tresen quellen die Lippen, die Augen hervor; darunter die dunklen tiefen Ränder. Der von irgendwann an dann hängen gelassene Schoss unter dem hängen gelassenen Bauch, den hängen gelassenen Brüsten, dem hängen gelassenen Gesicht. Sie beginnt mit dem täglichen Kampf gegen den Schmutz. Theater bis zur Vergasung. Der Mann, der mir öffnet, weist still mit der Hand, ringt die Hände, zieht sich zurück in sein Kontor. Für mich müssen die Fotos entlang den Wänden alles sagen. Manchmal ein Brief in lateinischer Schrift. Ich stelle dem Mann mit den ringenden Händen eine Frage. Er zuckt mit den Achseln, hebt die Hände an, sie öffnen sich. Er schüttelt den Kopf. Der Kopf des Mannes, der mir öffnet, ist gross. "Was möchten Sie trinken?" "Wasser." Die Wohnung ist angenehm kühl. "Auch Kaffee? Ich koche auch Kaffee. Siebente Generation." Er ist der, der fürs Theater schreibt. Morgens sehe ich ihn federnden Schrittes und gesenkten Kopfes mit seinem Hund zum Strand gehen, und zurück.
Tel Aviv hat keinen Zentrums-Brennpunkt, flattert herum. Sein wahres Zentrum ist dieses Von/Nach/Her/Hin. Jerusalem, Haifa, Tiberias, Be'er-Sheva, Eilat. Die Namen schon!
"Das Nes Ziona war meiner Familie erste Bleibe hier", sagt sie. Ich weiss nicht, zu wie vielen in einem seiner Zimmer mit Balkon sie damals, erschlagen von der Zeit hinter sich, dem Weg hierher, hausen. Auch der, der mir in Amsterdam ihre Adresse gab, wohnte vorübergehend da bei ihnen auf dem Balkon, einem Balkon nach hinten raus. Sie sind aus derselben polnischen Stadt. Vor einem Jahr sieht, sehen sie diese Stadt seitdem zum ersten Mal wieder. "Sie ist unwahrscheinlich! grossartig!", zerschlägt jede wesentliche Bestandaufnahme des angekündeten Geschehens und unserer Teilname im Voraus. Als Grossmutter haut sie, ein Derwisch mit deutschem Akzent und deutschen Brocken, auf die zu ihr gebrachten Enkelkinder ein. Verhältnisse rechts und links. Kommt alles wieder in Ordnung. Der Saal ist voll. Keiner hat die Kraft aufzustehen. Keiner verlässt Saal oder Bühne dieser Farce, für die er 50 Sheqel hingeblättert hat, in der er für Geld und Applaus auftritt. Sie und ihr Mann sind nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen, ihr Mann gerade in Deutschland. Sie kennen sich seit frühester Kindheit. Ihre Kindermädchen kannten sich, vielleicht waren es auch die Eltern. 1936 geht er von Deutschland aus nach Israel, sie, später, von Polen aus auf Transport nach Samarkand in ein Internierungslager. In Israel treffen sie sich wieder, heiraten. "Es ist schon viel", sagt sie, "dass die Schauspieler nicht wie aufgescheuchte Hühner auf der Bühne hin- und herflattern. Sie müssen nämlich wissen, wir sind immer ein bisschen zu - zu liebenswürdig, zu gefühlvoll, zu, zu. Und dann müssen wir uns straff in Zaum halten. Kommen Sie Freitag essen? Ich lade Gäste ein."
Vor der Cinemathek, da müsse sie auf die Organisatoren des Jüdischen Festivals aus Krakau warten. Ich setze mich auf eine der Bänke, schaue. Ihren Namen und ihre Adresse habe ich von dem Mann aus Warschau, dessen Bescheidenheit an Erliegen grenzt. Ich sehe sie kommen, sich vor den Eingang stellen. "Wie können Sie wissen, dass ich es bin?" Sie zieht den Ärmel hoch. Zieht ihn wieder runter. "Ja, Hass ist sinnlos. Ich schreibe es mir ab. Die Nummer geht nicht ab." Dann kommen die aus Krakau, der, der die Hände im Nacken gefaltet sich zurückstreckte. "Um 17 Uhr im Café?" Im Café liegt ein Brief für mich: Leider... Mit Blumen gehe ich zum Sabbatmahl, das morgen erst ist. Meine Zeit ist durcheinander geraten. Ihre Wohnung schaut aufs Meer. Die Einrichtung könnte in Deutschland, Polen, den Niederlanden stehen. Sie müssen weg. Sie klingelt bei einer Nachbarin: "Kümmere dich um sie." "Haben Sie Aids? Nehmen Sie Drogen?" Klebrige Zudringlichkeit der Hurenläufer.
Im Café gegenüber dem Theater warte ich auf die alte Schauspielerin. Sie kommt mit ihrem Mann. Geblähte Nasenflügel, gerümpfte Nase, extrem gespannte Augenbrauenbogen, setzt sie sich mir gegenüber, er setzt sich an die Bar. Als demonstriere sie, dass sie den Augen mehr und der Stirn weniger Raum zukommen lasse. Das sich den Blick, die Wahrnehmung erweitern geht vom Grund deines Schosses aus. Jede Haltung, die nicht von da ausgeht, dahin rückgekoppelt wird, erzeugt schliesslich Rückzug, endet in Abwehr, in Resignation. Sie weiss das und weiss, dass ich das weiss. "Habe ich Sie erschreckt mit dieser Grossmutter?" Muss der feuchte Film auf ihr die Hitze wehren? Dämpfen? Der Kopf ist zwischen die Schultern und nach hinten gedrückt, das Kinn nach vorn. Die Mundwinkel zieht sie scharf runter, als müsse sie mit ihnen das Kinn herausschneiden. Der Rumpf ist ein einziger Block. Sie ist Deutsche. Sie und er treffen sich nach dem Krieg. Sie geht mit ihm, konvertiert. Wasser tritt in ihre Augen, wenn sie spricht. Dieses Wasser, das wir vor uns ausschütten, das uns die Augen wäscht oder den Blick verschwimmen lässt. Etwas stülpt sie vor, wenn sie spricht, hält anderes verspannt unter Kontrolle. Weder Arme noch Beine scheinen im Rumpfblock verankert. Es muss schwer Wuchten sein, eisernen Willens. Der Kopf sitzt fest. Jetzt hat sie nur diese halbe Stunde für mich. "Später", sagt sie. Dies Später gibt es nicht. Ich gehe mit zur Verleihung des jährlichen Theaterpreises. Der Bürgermeister von Tel Aviv. Der jüdische Produzent vom Broadway mit der demonstrativ um seinen Hals gekräuselten jungen Schauspielerin. "Ich bewundere euer Spiel, euren Mut unter Intifada und Raketen zu spielen. New York! Aber erst kommen wir von da in dieses wunderbare Land mit diesen wunderbaren Menschen. Solidarität!" Beim Betreten von Warenhäusern und Supermärkten werden die Taschen kontrolliert.
Wieder kaufe ich Blumen. Gehe mit meinem Strauss runter zum Meer. Sitze da auf einem Stuhl, den Kopf an einen Pfahl gelehnt, das Gesicht der späten Sonne hingehalten. Noch zwei sitzen da. Eine graue Krähe. Sabbat rückt näher. Gepresst vor Aufgedunsensein, Schritt für Schritt, rudernder Arme... "Darf ich", fragt er in meine gerade dunkle Ruhe. "Bitte." Er rückt einen Stuhl ran: "Störe ich Sie auch nicht?" "Nein." Er ist irr, beissend einsam. Alles prallt an diesem Gesicht, dem Posten dieses Leibes ab. Seine Sätze sind knapp, die Lippen Striche. "Ich wettere an Strassenecken gegen Korruption; der Regierung, der Opposition. Menschenschweine. Du kannst Menschen so martern, dass sie es nicht mehr spüren. Vollkommen gefühllos alles tun. Alles mit sich geschehen lassen. Marter, Mord befehlen, ausüben. Der Sechs-Tage-Krieg. Krieg ist Zynismus. Gebiert Zynismus. Du lechzt nach Marter. Immer ärgerer. Ihrer Ausübung: du hast Macht über die Martyrer; ihrem Empfang: du spürst noch."
All die Gäste, die diese Menschen, die ich vor zwei Tagen zum ersten Mal anrufe, für mich eingeladen haben.
Am Sabbat bist du ohne eigenes Fahrzeug eine Gefangene der Stadt, des Stadtteils sogar. Ich gehe runter zum Strand. Schlafe in der Sonne. Ziehe mich auf mein Zimmer zurück. Gegen Abend laufe ich über den Strand nach Jaffa, durch die alte Stadt und in der Dunkelheit über den Strand wieder her. Die Huren, die in der Hitze des Mittags schon anschaffen stehen, stehen noch immer anschaffen. Zwischen Strand und Hotel laufen Männer hinter jeder Frau her, die unbemannt und nicht wirklich alt ist.
Der Busbahnhof wimmelt von Militär. In allen Bussen sitzen sie mit ihren Gewehren. Zurück nach Tel Aviv. Gegen Abend fahre ich mit dem Bus ins Gewerbe- und Handelszentrum weit im Süden der Städteballung. In einer ihrer Hallen stellen sie frische russische Emigrantenmaler aus. Sie stellen sie aus, versorgen die Verpflegung mit eigenen Fabrikaten: Keksen, Kuchen, Gebäck, Brötchen, Pasteten, alle nur denkbaren Naschereien, die der Mensch nicht nötig hat und doch in sich hineinstopft, zwischendurch, bei Gelegenheiten, vorm Fernseher. "Nehmen sie den Bus", sagt der Abendportier, "passen Sie gut auf sich auf." Sich fein gemacht habende Menschen strömen her. Im Fabrikshof stehen unter Sonnenabschirmungen lange Tische mit eben diesen Keksen, Kuchen, Brötchen, Pasteten und Limonade, Papptellern, Pappbechern, Servietten. Neben der Tür zur Halle steht ein Podium mit Mikrofon, Miniband und Sängerin. Alle Stühle sind schon besetzt. Wer jetzt noch kommt, muss stehen. Ich gehe in die Halle und wieder raus. Macht das ihr Leben aus? Sind sie dafür hergekommen? Eine Ansprache. Und dann stürzen sich alle unter live Musik auf die Tische, als sei zack! ein Vakuum in ihnen eingeschaltet. Ein, zwei, drei, vier Stücken Kuchen landen auf einem Pappteller. Hände voller Kekse. Süsse Pasteten. Sie umkreisen die Tische. Noch ein Becher Limonade. Gehen wieder hin, kauend noch, sich die Finger ableckend. Tabletts mit Kroketten. Ich gehe wieder in die Halle. Ich weiss, dass so gemalt wird, überall auf der ganzen Welt. Lechzen sie da nach dieser Hänsel-und-Gretel-Freiheit, dieser Nachahm-Chagall-Welt, diesen hingehauenen Abklatschen. "Welche Chance sie verspielen!" "Essen Sie wenigstens etwas." Wieder gehe ich raus in das Bunkern des Verzehrs in Leiber. Nach vier Stücken Kuchen ist es nur noch in Hälse stopfen, schlucken. Es muss die Schlunde aufreissen, kein Mund ist fähig die dafür nötigen Mengen Speichel zu erzeugen. Limonade. Huriges Reinstopfen. Süsses Löschen. Ich gehe noch einmal in die Halle. Stehe lange noch am Rande dieser billigen Orgie nie zu stillenden Hungers. Keiner ist dünn. Ich will Wein kaufen, will mich besaufen. Ich kaufe keinen Wein. Morgen laufe ich mit einer Gruppe fünf Stunden durch die Wüste Judäas.
Das Zerreissen des Tempels Vorhangs, Brechen des Brotes, Steinigen von Sündern, gemeinsame Stippen des gebrochenen Brotes in die rote Tunke: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen!", Benetzen der Lippen des am Kreuz Sterbenden mit Essig, Öffnen der Seite des Toten. In meinen Zeichnungen des Haltens der Abgenommenen hält immer der Mann den Leichnam der Frau. Das Gewimmel auf den Strassen. Männer in schwarzen Mänteln mit Hüten, Kippas, Gebetsriemen; auch Kinder schon. Ein Blick auf diese und jene Sehenswürdigkeit, entlang den Ausgrabungen der Stadt König Davids, dem Haus, wo ehedem die Grenze verlief. Unser Ziel ist der biblische Fluchtweg im Bett des Wadis Quelt zwischen Jerusalem und Jericho entlang dem Aquädukt, das Wasser aus dem Jordan hierher schaffte. Die immensen Mengen jetzt benötigten Wassers werden via Rohrleitungen übergepumpt. Indischgelbe verbrannte Landschaften mit indischgelben Menschen. Sand rast über alles, frisst aus, schmirgelt. Gelbe Gesichter, Häuser kaum zu unterscheiden vom zerklüfteten Land, erdiges Gelb durchsetzt mit Rot. Immer wieder stosse ich in meinen Texten, meinen Bildern auf Wüsten, muss sie durchqueren. Ich weiss nicht, woher in mir sie stammen. Nur wenige Schritte östlich des Ölbergs ist es so. Wir halten Pause bei der Herberge zum Barmherzigen Samariter. Auf dem Parkplatz steht ein Beduinenzelt mit Tee trinkenden Männern in Kaftanen, steht ein angebundenes Kamel. Hier noch und schon zeichnen sich die östlich Jerusalems viereckig aus der Wüste Stein hochgezogenen israelischen Siedlungen ab. Dann werden wir in der Wüste abgesetzt. Wir sind ungefähr fünfundzwanzig. Zur gleichen Zeit werden noch zwei grosse Busse entladen. Der Massentourismus schlägt erbarmungslos zu. Die Route ist gut angegeben. Ich winde mir den Schal um den Kopf, kremple die Ärmel runter. Männer und Frauen krempeln sich die Ärmel hoch, ziehen Shorts an. Nachts kommen die Bilder, bewegen.
"Kann ich Sie noch treffen", fragt die Stimme am Telefon. Ihr Name fällt beim Sabbatmahl. Ich bin so alt wie sie, als das Kind, das ich gebäre, stirbt. Das zweite. Sie ist schön, bewegt sich und dann nicht mehr. Zwölf Stunden. Von da an ist mir bewusst, dass jeder Augenblick immer der erste, der letzte, alles ist. Meine Zeichnungen von hier sind anders. Im Museum sehe ich das durch den Verstand nicht beeinflussbare Hintergrundbild in einem Picasso. Ein milchiger Hauch nur.
Jerusalem. Soldaten, Orthodoxe, Ankömmlinge, Abreisende. Wieder durch Jerusalems wirre Strassen. Am King David Hotel vorbei, einer Windmühle, dem Bahnhof. Vor zwanzig Jahren kommt sie für immer nach Israel. Verlässt das Leben in der Schweiz, die sie immer nachdrücklicher und beklemmender vereinnahmende Sicherheit. Der Sohn ist erwachsen. Die Schweiz ist noch immer spürbar anwesend. In kleinen Dingen, in der Einrichtung, dem Akzent. "Israelis schreiben nicht", sagt sie. Von der Instanz in Jerusalem bekomme ich eine Telefonnummer. Von da aus probieren sie die Verbindung mit dem Sinai herzustellen. Das gelingt nicht. Das zweite Mal auch nicht. Das dritte Mal auch nicht. Ich weiss nicht einmal, ob M da ist. Gegen Abend bin ich in der Stadt, im Strom der Orthodoxen, Russen, Polen, Deutschen: Israelis. Auf dem Bürgersteig kauert eine Bettlerin. Mit Einbruch der Dunkelheit ist es kühl. Im Tumult der Ben Yehuda singt ein Opernsänger, spielt ein Geigenvirtuose, ein Quartett, singt eine Frau ungarische Lieder zum Zimbal. Ich bleibe stehen, gehe weiter, esse irgendwo wie alle hier ein aufgeschnittenes mit Fleisch und Salaten und Humus - Kichererbsentunke - gefülltes Fladenbrot, laufe durch Strassen und Gassen, komme aus stillen Gegenden wieder in die Strasse des Sängers, des Geigenvirtuosen, des Quartetts, der singenden Frau. Immer verlaufe ich mich leichter in Städten, auch in denen, die ich schon immer durchstreife, als in Wäldern, auf dem Lande. Ich gehe zu Fuss nach Abu Tor. Da oben liegt die Altstadt.
Ich wähle die Telefonnummer von Hanna. Ihr Englisch kommt mit starkem deutschem Akzent. "Jetzt sind die Ofensetzer da", sagt sie. "Nach zweiunddreissig Jahren leiste ich mir einen Ofen!" Um 18 Uhr. An der Ecke will sie mich abholen, das sei besser: Grund und Boden vorbei des Hauses und von der anderen Strassenseite an runter ins Tal sind arabisch.
18 Uhr. Es ist dunkel. Ich stehe an der Ecke. Ich weiss auch die Hausnummer nicht mehr. Sie kommt auf mich zu. Wir strahlen uns an. "Hanna!" "Sabine!" Ihre Hände wissen, wie sie Werkzeuge halten müssen. Es liegt Nachdruck in ihrem Daumen wie in einem Hammer. "Die Ofensetzer", sagt sie, "den ganzen Tag die Ofensetzer." Ihr Haus ist ein altes Araberhaus. Die Mauern sind bis zu 90 cm dick. Vor 1968 liegt die Front des Hauses direkt an der Sperre der Grenze, mit Tag und Nacht den Patrouillen und nur via den Hintergarten zu erreichen. "Wir lieben es sofort. Es ist nicht teuer."
Ein paar Monate später kommt sie nach Zaltbommel: "Neulich ruft jemand an, sagt: 'Ich komme aus Amerika. Ich bringe Ihnen Ihre Ziehharmonika.' Ich habe meine Ziehharmonika wieder.""1948 umzäunen die ersten ihre Parzellen. Bis dahin ist keiner mehr oder weniger als der andere. Ich arbeite in einem Modeatelier als Näherin. Dann nebenher zur Akademie. Mit einem Mitstudenten stehe ich oberhalb Jerusalems. Mit strahlendem Gesicht erzählt der die abscheulichsten Dinge. Theresienstadt. Auschwitz. Lacht. Wir lachen. Erst viel später dringt zu mir durch, dass es sich um leibhaftige Erfahrungen handelt. Dann kann ich in Schweden studieren. Ich habe kein Geld, gerade soviel, dass ich hinkommen kann. Ich muss nebenher arbeiten. Der Direktor lässt mich kommen. Dann wählt er eine Nummer, sagt ins Telefon: 'Haben wir ein Stipendium?' Innerhalb von weniger als fünf Minuten, Sabine, habe ich ein Stipendium. Für drei Jahre. Drei Jahre ohne die Sorge um das leibliche Wohl! Immer, wenn ich denke: jetzt ist Schluss, wirklich, passiert etwas. Ich will das Denkmal für die Mengelezwillinge fürs Yad Vashem machen. Muss es machen. Ich - alles geht schief - ich bekomme den Auftrag. Vor fünf oder sechs Jahren bin ich in Berlin. Gehe sofort zum Reichstag. Ich will ihn sehen, wissen, dass er kein Phantom ist. Seit ich elf bin und im Zug dran vorbeikomme, spukt er mir durch den Kopf." Sie hat noch zwei süsse Kartoffeln, Salat, Humus und Eierpflanzen (Auberginen). "Ich wollte noch einkaufen gehen - die Ofensetzer." Sie röstet die Auberginen, bis die Schale vollkommen verkohlt ist, schabt das so gegarte Fruchtfleisch aus. "Tut Ihr das alle so?" "Ja." Ob Niederländer tatsächlich so ihrer Gefühle beschnitten seien, fragt sie. Ich weiss nicht, wo in euch und was ihr fühlt, seit wann ihr euch eure Extreme so stutzt. Ihr tut es, ein jeder von selbst. "Am ausgestreckten Arm verhungerst du emotional in den Niederlanden gerade nicht", sagte mir ein in Amerika geborener Jude deutsch-jüdischer und niederländisch-jüdischer Eltern. In Amsterdam betreibt er Handel, dafür sei das Pflaster da gut. Hanna mit dem schräg gehaltenen Kopf, grauen Haar, entwaffnenden breiten Lachen. Ihre Hände können halten. Der etwas grosse Hoffnungsschimmer: dass alles gut und ausgewogen sei. "Dann muss das Gezeigte dem Wunsch entsprechen." "Ja. Ja." Es ist spät. Sie bringt mich bis hoch an die grosse Strasse. Morgen nach 11 Uhr gehen wir zusammen in die Stadt. "Du kannst bei mir wohnen", sagt sie. Es kalt kalt.
"Bitte, meine Damen! Bitte, meine Herren!", sagt der Mann in roter Weste, die Hände ausstreckend, sie sich trocken waschend. Direkt beim neuen Tor setzen wir uns in ein Wiener Café mit arabischem Hauch, bestellen Kaffee und irgendetwas entsetzlich Süsses. Wir gehen zu Isaak. Isaak ist Töpfer. Isaak isst liebend gern. Ist dick. Quirlig. Lacht. Sein Bart ist grau. "Kaffee? Kuchen?" Die Mütze setzt er nie ab. Siebente Generation. Er wohnt und arbeitet mitten im alten Jerusalem, im israelischen Viertel. "Es gibt Juden, die in Israel geboren sind", sagt er. Er arbeitet mit äthiopischen Juden, lehrt sie aus der ihnen eigenen Kreativität Geld zu schlagen. Noch sind die Tonfigürchen Kunst, ein Stück Leben. Irgendwann tastet die Unrast in Panik gespitzter Sinne, die hier herrscht, ihren tief in ihnen ruhenden Rhythmus und die Figürchen an. Der Kuchen ist entsetzlich süss.
"Nachher kommen zwei Polen", sagt er. Ich lache, nenne die Namen der Organisatoren des Jüdischen Festivals aus Krakau. "Du kennst sie? Sabina, fühlst du dich hier in den Strassen schuldig?" "Nein." "Was empfindest du." Der Kontrollposten. Die Klagemauer. Geschieden von einander, stehen rechts die Frauen, links die Männer. Der Frauentrakt ist nach hinten zu offen, der der Männer mit Seilen abgegrenzt. Der der Männer grenzt an die Tür des Tempels. Sie schlagen die Hand auf den Stein, stecken Briefchen in die Fugen. Die Männer nicken und nicken mit den Oberkörpern aus den Hüften, tragen Thorarollen. Fellmützen, schwarze Hüte, Kippas. Niemand kehrt dieser Mauer den Rücken zu. Rückwärts gehend entfernt man sich aus ihrem Bann. Hanna stösst mich an: "Spürst du es!" Ob die Menschen mit ihrem Herkommen, ihrem rhythmischen aus der Hüfte Nicken, ihren schwebenden Klängen, ihrem Fixiertsein durch/auf die Mauer dieses Etwas zuwege bringen? Ob der Ort so ist? Ich muss diesen Ort ohne Menschen sehen. "Hast du auch schon einmal dagestanden, ein Briefchen in eine Fuge gesteckt." "Ja." "Hat es geholfen?" "Ja." Der Geldautomat schluckt ihre Karte. Spuckt sie nicht mehr aus und auch kein Geld. Von jetzt an herrscht Sabbat. Im armenischen Viertel kaufen wir noch Kohl. "Du hast nichts heute Abend?" Isaak und Hanna essen heute bei einer Bekannten. Sie ruft diese Bekannte an. Ich gehöre heute zu ihnen. Der Fotograf, der sie für die Schulz-Büste vorgeschlagen hatte, ruft an. Er will mich sehen. Sonntagabend. "Ich hätte es gekonnt", sagt sie.
Früh schon fährt meine Gastgeberin mit mir in die Pinienwälder westlich Jerusalems. Wir kommen durch Emmaus. Kein Ort hier, dessen Name ich nicht schon immer kennte. |
 Ich fahre zum Busbahnhof. Ich will riechen, dass ich die Stadt verlassen kann. Städte sind Ellipsen, Anhäufungen von Ellipsen. Mit dem als Zentrum anerkanntem Brennpunkt und jenen, wo du ankommst, von wo du weg kannst.
Ich fahre zum Busbahnhof. Ich will riechen, dass ich die Stadt verlassen kann. Städte sind Ellipsen, Anhäufungen von Ellipsen. Mit dem als Zentrum anerkanntem Brennpunkt und jenen, wo du ankommst, von wo du weg kannst.
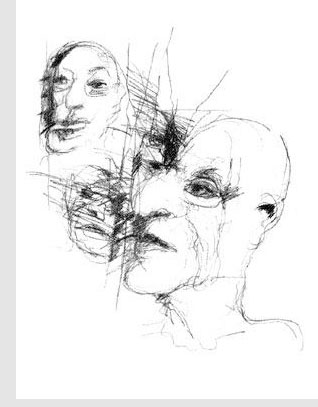 Gleich hinter dem Jaffator kommen sie auf mich zu: "Führer? Durchs arabische Viertel?" Die Intifada hat die Strassen des Bazars nahezu leergefegt. Arabische Händler treten einen Schritt vor, strecken ihre Hand aus: "Bitteschön!" Schwere Ausdünstungen von Kräutern und Pulvern. Ein Gewölbe mit Gemüse, mit Säcken Bohnen, Erbsen, daneben sitzt ein Alter, reglos, still, nur die Gebetsperlen in der Hand bewegend. Teppiche, Schmuck, die von Kräutern scharfe Luft, Gläser. Der Bazar wird schummriger. Immer mehr Läden sind geschlossen. Es herrscht Streik. Lächeln! Ich spreche kein Iwrith. Natürlich komme ich aus dem Westen. Ich bin eine Frau. Allein. Ich kehre um.
Gleich hinter dem Jaffator kommen sie auf mich zu: "Führer? Durchs arabische Viertel?" Die Intifada hat die Strassen des Bazars nahezu leergefegt. Arabische Händler treten einen Schritt vor, strecken ihre Hand aus: "Bitteschön!" Schwere Ausdünstungen von Kräutern und Pulvern. Ein Gewölbe mit Gemüse, mit Säcken Bohnen, Erbsen, daneben sitzt ein Alter, reglos, still, nur die Gebetsperlen in der Hand bewegend. Teppiche, Schmuck, die von Kräutern scharfe Luft, Gläser. Der Bazar wird schummriger. Immer mehr Läden sind geschlossen. Es herrscht Streik. Lächeln! Ich spreche kein Iwrith. Natürlich komme ich aus dem Westen. Ich bin eine Frau. Allein. Ich kehre um.