 index reiseberichte.... zurück.... weiter index reiseberichte.... zurück.... weiter
|
|
"Herbata, kein Tee", sagt der Mann, mit dem ich im Zug nach Czestochowa Tee trinke.
Czestochowa. Sonntag, halb zwölf. Schon südliche Stadt, Sonntagskleider, kein Taxi. Ich laufe zu meinem Hotel, das am Fuss des Klosterbergs zu Füssen der Schwarzen Madonna steht. Aus einer Kirche tönen Messgesänge. Kirchgänger stauen sich am Eingang.
Nach der Messe dringt die Masse ins Kloster. Ein alter Mann bleibt mitten auf dem Rasen knien; auf einem Bein, auf das andere stützt er die Arme, sein Kopf liegt in den abgearbeiteten Händen. Alte liegen schlafend da. Wojtylas, Maschinenpistolen aus Plastik, Kessel mit dampfender Suppe. Ein Priester in weissem langem Hemd spendet alle fünf Minuten Gottes Segen. Eine Frau aus dem Volk darf sagen, für wen insbesondre. Der Priester nimmt den Satz wieder auf. Wojtylas und Schwarze Madonnen werden hochgehalten. Der Priester sprengt das Weihwasser mit einem Reisigbesen: Heilige Samenausstreuung, alle fünf Minuten! Vierzig Beichtstühle unter freiem Himmel. Alle wollen beichten. Tausende. Die Priester neigen ihre Köpfe nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Absolution am laufenden Band und unter gemurmelten Bussgebeten geht's unverzüglich weiter zur Heiligen Kommunion, dringt der Leib des Herrn in sie ein. Er will es so. Es ist heilig! Ich bin in einer indisch gelben Sandlandschaft. Indisch gelb/orangefarbene Menschen stehen am Strassenrand. Sie sind plump, ihre teigigen Leiber wogen auf, ab, nach rechts, nach links. Massige Köpfe, träge hochgezogene Augenbrauen, träge gespannte, wulstige Lippen. Die Lippen fallen nicht auseinander. Aus den Schädeln kommen dünne Hälse, zweite Köpfe.Alle wollen die Schwarze Madonna sehen. Die Schlange ist mir zu lang. Ich laufe ums Kloster. Ein Kreuzweg. Überall singende, betende, kniende Menschen. Ich zwänge mich durch in die Kapelle, die Basilika, das Refektorium, das Wojtyla-Museum. An allen Altären werden Messen gelesen. Zurück zum Hotel. Die hutzelige Einarmige kniet regungslos, der Ausgemergelte steht verrenkt. Romnija wollen mir die Hand lesen. Die meisten Leute sind dick, watscheln. Wenn der Rumpf die Oberschenkel erobert hat, läuft man so. Um halb vier gehe ich wieder hin. Ich will die richtige Schwarze Madonna sehen, nicht nur ihren vergrösserten Abklatsch an der Klostermauer von dem aus die Masse bespielt wird. Der Ausgemergelte steht. Die Hutzelige kniet. Die Schlange vor der Schwarzen Madonna misst keine 150 m mehr. Ich stelle mich an. Der Italiener neben mir hatte seiner Mutter versprochen bei der Schwarzen Madonna für sie zu beten. Meine Mutter gab mir ihren Segen zu dieser Reise, als sie hörte, dass ich auch nach Czestochowa fahren würde. Nach fünfzehn Minuten verlässt der Italiener die Schlange. Er muss nach Zakopane. Ich bleibe. Kaum beleuchtet, kaum eines Blickes gewürdigt, hängt die Madonna gleich rechts an der Wand. Ringsherum an allen Wänden stehen Vitrinen voller Juwelen, Gold, Silber, Münzen, Kelchen, kostbarer Gewänder. Geschenke von geistlichen und weltlichen Persönlichkeiten (meist ist vermerkt, von wem) für erwiesene gute Dienste oder als Vorschuss. Die Leute können sich nicht satt genug sehen. Der Glaube ist fester denn je.
Der Ausgemergelte steht noch immer da. Menschen stellen sich auf die Waage. Die Hutzelige ist weg. Ich will in der Stadt essen. Die Restaurants sehen aus wie Wartesäle dritter Klasse. Wie die Leute mich anschauen. Ich bin doch nicht nackt. Ich flüchte mich in mein Hotel. Werde im Speisesaal abgewiesen. Ich frage den Portier, wo ich essen darf. Er wird das für mich regeln, ich bin ja Hotelgast. Ich darf essen. Mein Tisch hat Platz für sechs Personen. Ich sitze da, warte. Der Ober kommt. Ich bestelle. Nach langem Warten bringt der Ober schon mein Gläschen Wein. Orbis steht auf dem Glas. Ein jugoslawisches Ehepaar kommt. Sie wollen sich zu mir an den Tisch setzen, dürfen sich nicht zu mir an den Tisch setzen, müssen auf Stühlen an der Wand Platz nehmen, warten, bis ein Tisch für sie frei geworden ist. Ich bekomme mein Essen. Die Jugoslawen ihren Tisch. Ich möchte noch ein Gläschen Wein. Lange muss ich darauf warten. Ich winke dem Ober, ich will bezahlen, ich will hier raus. Der Ober nickt, kommt nicht. Die Jugoslawen sind inzwischen abgefertigt. Gehen. Drei Italiener setzen sich zu mir an den Tisch. Sie dürfen sich nicht zu mir an den Tisch setzen. Ich will bezahlen. Der Ober nickt, kommt nicht. Die Tür geht auf, ein Mann eilt auf eine Tischgesellschaft zu und ruft: "Wie toll diese polnischen Eisenbahnen doch sind! Ich komme eine Stunde zu spät am Bahnhof an, steige ein, der Zug fährt ab!" Endlich darf ich diesen Raum wieder verlassen. Hinter der Tür fängt mich der Portier ab. Für seine Vermittlung will er ein Trinkgeld. Ich gebe es ihm. Spät abends sitze ich mit den Italienern, Moritz, Roberto, den dritten Namen habe ich vergessen, im Nachtclub des Hotels. Der Tisch, an den wir uns setzen, ist nicht für Gäste bestimmt. Da sitzt immer der Direktor, wenn er kommt. Der Tisch bleibt den ganzen Abend leer. Moritz bittet eine dicke Frau um Feuer. Dafür müsse er mit der noch dickeren Tochter tanzen. Er tanzt mit der Dicken. Um acht Uhr fährt mein Zug, um sieben Uhr ist Frühstück. Ich bin die erste, setze mich, warte. Die Herren, die nach mir kommen, das jugoslawische Ehepaar bekommen ihr Frühstück. Ich scheine Luft zu sein. Endlich kommt jemand. Ich bekomme zwar schon Kaffee, aber erst wollen sie sich noch beim Empfang erkundigen ob ich Recht auf Frühstück habe. Siebenunddreissig Dollar habe ich für diese Behandlung bezahlt. Als dann mein Brot kommt, kann ich gerade noch einen Bissen runterwürgen. Mein gestern notiertes Taxi ist nicht da. Sie können gar kein Taxi bestellen, haben keine Funkverbindung zu Taxis. Der Portier rennt spastisch, als koste es sein Leben, auf die Strasse, fuchtelt mit den Armen in der Luft herum: ein aufgebrachter, sich aufbäumender Riesenkäfer. Die Spillerbeine. Kein Taxi. Lethargie, unterbrochen von panischen Handlungen. Roberto sagt, Süditaliener seien genauso arm wie Polen, sähen jedoch nicht so tragisch aus. Er vergisst, dass Süditaliener näher der Sonne leben.
Krakau. Es ist warm. Ich gehe durch die Menge zum Taxistand. Begreife schliesslich, dass diese hunderte von Menschen alle auf ein Taxi warten. Welch wesenloses Stehen, auf Gepäckstücken Sitzen. Ich nehme meinen Rucksack, laufe zum Francuski. Durch den Grüngürtel, das Tor, nach rechts. Der Rucksack ist nicht leicht. Die Strasse beult aus. An der Stadtmauer hängen Bilder, davor stehen Menschen. Nach dieser Ausbeulung der Strasse bin ich da. Das Francuski ist ein altes Hotel. Dieser eigentümliche Marktplatz rings um die alte Tuchhalle, nie weisst du, was auf der anderen Seite passiert. Immer wieder laufe ich um dieses Spielzeug herum, hindurch wie ein Kind, laufe beinahe tänzelnd weiter. Streichele einem gelangweilt daliegenden Steinlöwen die Tatze. Befinde mich in einer schmalen gewundenen Gasse. Immer enger rücken die hohen grauen Fassaden zusammen, lassen modrige Dämmerung herrschen. An manchen klebt ein verrosteter Balkon. Fauliger Atem alter Gemäuer. Irgendwo stand ein Tor offen. Ich gehe zurück, stecke meinen Kopf rein, tue einen Schritt ins Innere. Erschaudere. Bin wieder draussen. Der Strassenschlund öffnet sich. Ich stehe in der Sonne, zu Fuss des Wavels. Durch andere Strassen laufe ich zurück zum Markt und immer wieder um und durch die Tuchhalle. Enge, oft schummrige Durchgänge führen in andere Gegenden. Ich bin in einer viereckigen Arena, umstellt von grosszügigen Fassaden, schlendere an Kartoffelpuffer essenden Menschen vorbei.
Stundenlang laufe ich durch die Strassen. Von Häusern und Menschen bröckelt es ab. Häuser und Menschen verfallen, sacken in sich zusammen. Hier und da werden Risse, Falten mit neuem Putz verschmiert. Der blättert wieder ab. Krakau im Regen verliert nicht an Charme. Im strömenden Regen treffe ich auf Roberto. Wir umarmen uns stürmisch. Wie leicht es ist jemanden zu umarmen, der vor zwei Tagen noch nicht bestand und morgen nicht mehr bestehen wird. Verbündete für einen halben Tag, schlendern wir durch die Stadt, schauen in Hinterhöfe, gehen durch Strassen und Gassen, über Plätze, am Fluss entlang, wollen in einer Bar etwas trinken: "Nie ma!", sehen uns Kirchen an, betende Leute, an Kirchentüren klebende Todesanzeigen, wartende Leute vor Geschäften, an Haltestellen, trinken irgendwo Kaffee. Wie die alternden Frauen ihre Leiber verwahrlosen, von innen her verkommen, hängen lassen. Hier werden sie schon früh alt. Müssen, wollen sie sich zeigen, richten sie die Aussenseiten her, stützen sie ab. Ganz Polen scheint Museum. Auf Filzlatschen hinter dem Führer her. Niemand sondert sich ab. Schlange stehen vor der Wavelkasse. Wieder habe ich so ein Gefühl, als stünden sie eben da, sei es egal, wo sie stehen, ginge es um dieses Stehen. Beim Frühstück setzt er sich zu mir an den Tisch. Weint trockene Tränen. Sagt, dass das sein Ende sei. Seine Hände beben. Ich kann ihm nicht helfen; in welcher Angelegenheit denn. Er steht wieder auf. Am Nachmittag setzt er sich zu anderen an den Tisch.
Auch bei Tageslicht schaudert's mich beim Betreten des Hauses. Ich klingele. Kowalski öffnet. Stimmen dringen aus seiner Wohnung. Er hat sich fein gemacht. Riecht nach billigem Kölnisch Wasser. Ich werde ins ehemalige Zimmer seiner Tochter komplimentiert. Er fasst meine Hände, sein Lächeln erstarrt an der Grenze zum Grinsen, seine Augen strahlen: "Frau", sagt er und seine Stimme schnappt beinahe über, "Kowalski chaat Glieck! Kowalski chaat Glieck! Komen sechs Jugoslawen, wolen schlafen bei mir. Muss ich draai schiecken zu Schwääster. Sie komen. Frau, Kowalski chaat Glieck! Bóze, Bóze!" Er holt Kaffee in Porzellantassen mit Untertassen. Lächelt wieder dieses kurz vor Grinsen festgehaltene Lächeln: "Schauen Sie, Frau, chaab ich mich faain gemacht, firr Sie." Seine Hände halten sich an den Revers fest, der Kölnisch Wassers Dunst setzt sich mir in der Nase fest. In ihr Lachen mischt sich etwas Trauriges. Wie lange ist Lachen klar?  ........ ........ |
 index reiseberichte index reiseberichte
|
 Menschen, unheimlich viele Sonntagsmenschen. Singend, betend, auf Knien rutschend, bewegt sich die Masse hin zur Schwarzen Madonna. Limonade, Eis, Kuchen, Spielmäuse. Ein alter Mann hat eine Waage mitgebracht. Für fünf Zloties kannst du dich wiegen. Schwarze Madonnen und Wojtylas in allen Grössen. Manche zwinkern, hin und her bewegt, mit den Augen.
Menschen, unheimlich viele Sonntagsmenschen. Singend, betend, auf Knien rutschend, bewegt sich die Masse hin zur Schwarzen Madonna. Limonade, Eis, Kuchen, Spielmäuse. Ein alter Mann hat eine Waage mitgebracht. Für fünf Zloties kannst du dich wiegen. Schwarze Madonnen und Wojtylas in allen Grössen. Manche zwinkern, hin und her bewegt, mit den Augen.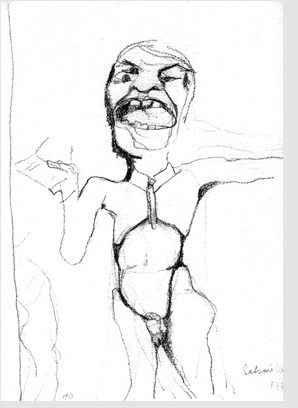 Schon von weitem höre ich seinen Gregorianischen Gesang. In dunklem Anzug, weissem Hemd, mit ausgebreiteten Armen steht er, erhobenen Hauptes, vor einer Säule mit Madonna. In der Linken hält er ein Gebetbuch. Er ist noch jung. Um ihn herum knien Frauen, auch ein paar Männer. Er schmettert eine Litanei in Richtung Säule. Die Madonna lächelt. Ein Auge hält er auf die Knienden gerichtet. Ihr Knien richtet ihn auf. Sie sind seine Untertanen. Einige erheben sich. Der Gesang wird dünner. Man geht. Er kniet ein letztes Mal - mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa - wirkungsvoll nieder, klappt hörbar das Gebetbuch zu. Einige der Umstehenden bekreuzigen sich noch.
Schon von weitem höre ich seinen Gregorianischen Gesang. In dunklem Anzug, weissem Hemd, mit ausgebreiteten Armen steht er, erhobenen Hauptes, vor einer Säule mit Madonna. In der Linken hält er ein Gebetbuch. Er ist noch jung. Um ihn herum knien Frauen, auch ein paar Männer. Er schmettert eine Litanei in Richtung Säule. Die Madonna lächelt. Ein Auge hält er auf die Knienden gerichtet. Ihr Knien richtet ihn auf. Sie sind seine Untertanen. Einige erheben sich. Der Gesang wird dünner. Man geht. Er kniet ein letztes Mal - mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa - wirkungsvoll nieder, klappt hörbar das Gebetbuch zu. Einige der Umstehenden bekreuzigen sich noch.
 Der Zug hätte längst weg sein müssen. Noch wird der Bahnsteig immer voller. Ob Polen einfach zum Bahnhof gehen, den nächsten Zug nehmen, egal wohin? "Krakau", frage ich sicherheitshalber.
Der Zug hätte längst weg sein müssen. Noch wird der Bahnsteig immer voller. Ob Polen einfach zum Bahnhof gehen, den nächsten Zug nehmen, egal wohin? "Krakau", frage ich sicherheitshalber. Café Literacka. Hier sitzen viele alte Männer. Man unterhält sich angeregt, doch herrscht wohltuende Ruhe. Ich bestelle einen Kaffee. Und noch einen. Bleibe lange sitzen.
Café Literacka. Hier sitzen viele alte Männer. Man unterhält sich angeregt, doch herrscht wohltuende Ruhe. Ich bestelle einen Kaffee. Und noch einen. Bleibe lange sitzen. Es ist schon dunkel, regnet. Ich will in der Stadt essen. Vor dem Hotel stehen zwei Männer. Der ältere, untersetzt, kommt hinter mir her, hält seinen Schirm über mich, spricht deutsch. Sein Kopf ist nach allen Seiten gleich gross. Grosse Nase, fleischiges, schon erschlaffendes Gesicht. Manchmal spannen sich seine Züge. Als schlüge der Mund mit dieser Überstraffung der Nase-Kinnlinie die nicht mehr aufzuhaltende Verlederung der Wange zurück. Er fragt, wo ich essen wolle, empfiehlt ein besseres Restaurant. Spricht von seiner Tochter. Sie braucht Westgeld. Alle brauchen sie Westgeld. Das Restaurant sieht aus wie eine Bahnhofsgaststätte. Er hat schon gegessen, will auch nichts mehr trinken. Die Suppe gibt es nicht, das Mineralwasser auch nicht. Er sucht etwas für mich aus. Beobachtet mich, nur auf dem vordersten Rand seines Stuhls sitzend. Ich sehe ihn denken: Wie viel? Der nasse Regenschirm zwischen seinen Beinen. Das Essen ist fett. Er zeigt auf die Pommes, drängt mich alles aufzuessen: "Missen krääftig wäärden", lächelt. Ich bin seine Beute. Merkt er, dass ich ihn ansehe, setzt er die Lächelgrimasse auf, entblösst die Zähne knapp. Wir verlassen das Lokal. Er lädt mich ein das Mineralwasser bei ihm zu trinken. Ich gehe mit ihm. Das Treppenhaus! Nur bis zur ersten Etage. Er zeigt mir stolz die Wohnung, die er oft an Fremde vermietet. Ein Zimmerchen mit riesigem Doppelbett und Schrank, die Küche mit Schrank und Gasherd, das Badezimmer, ein Zimmer, in dem bis vor kurzem noch seine Tochter, ihr Mann und ihre zwei Kinder gewohnt haben: "Muss renovirrt wäärden." Der in die Mitte gerückte Schrank trennte Schlaf- und Wohnquartier der Vier. Er steht noch immer da. "Ales muss renovirrt wäärden", ist verwohnt, verschlissen.
Es ist schon dunkel, regnet. Ich will in der Stadt essen. Vor dem Hotel stehen zwei Männer. Der ältere, untersetzt, kommt hinter mir her, hält seinen Schirm über mich, spricht deutsch. Sein Kopf ist nach allen Seiten gleich gross. Grosse Nase, fleischiges, schon erschlaffendes Gesicht. Manchmal spannen sich seine Züge. Als schlüge der Mund mit dieser Überstraffung der Nase-Kinnlinie die nicht mehr aufzuhaltende Verlederung der Wange zurück. Er fragt, wo ich essen wolle, empfiehlt ein besseres Restaurant. Spricht von seiner Tochter. Sie braucht Westgeld. Alle brauchen sie Westgeld. Das Restaurant sieht aus wie eine Bahnhofsgaststätte. Er hat schon gegessen, will auch nichts mehr trinken. Die Suppe gibt es nicht, das Mineralwasser auch nicht. Er sucht etwas für mich aus. Beobachtet mich, nur auf dem vordersten Rand seines Stuhls sitzend. Ich sehe ihn denken: Wie viel? Der nasse Regenschirm zwischen seinen Beinen. Das Essen ist fett. Er zeigt auf die Pommes, drängt mich alles aufzuessen: "Missen krääftig wäärden", lächelt. Ich bin seine Beute. Merkt er, dass ich ihn ansehe, setzt er die Lächelgrimasse auf, entblösst die Zähne knapp. Wir verlassen das Lokal. Er lädt mich ein das Mineralwasser bei ihm zu trinken. Ich gehe mit ihm. Das Treppenhaus! Nur bis zur ersten Etage. Er zeigt mir stolz die Wohnung, die er oft an Fremde vermietet. Ein Zimmerchen mit riesigem Doppelbett und Schrank, die Küche mit Schrank und Gasherd, das Badezimmer, ein Zimmer, in dem bis vor kurzem noch seine Tochter, ihr Mann und ihre zwei Kinder gewohnt haben: "Muss renovirrt wäärden." Der in die Mitte gerückte Schrank trennte Schlaf- und Wohnquartier der Vier. Er steht noch immer da. "Ales muss renovirrt wäärden", ist verwohnt, verschlissen.